Immer mehr Beschäftigte leiden an psychischen Belastungen. Krankenkassen berichten von steigenden Fehlzeiten wegen Depressionen und Burn-out. Für mittelständische Betriebe, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, ist das eine doppelte Herausforderung: steigende Kosten und knapper werdende Fachkräfte. Doch es gibt Ansätze, die Hoffnung machen – etwa das Clubhaus Schwalbennest in München.
„Die Arbeitslast ist einfach mehr geworden, dichter geworden, es ist mehr Druck und damit kommen viele auf Dauer nicht zurecht. Und dann ist das Problem, dass man das immer unterdrücken muss, dass man ja nicht offen drüber reden darf“, sagt Vera Hahn, Pädagogin und Leiterin im Clubhaus Schwalbennest. „Ich glaube, das wäre ein ganz wichtiger Punkt, was man verändern könnte: dass man einfach offen darüber reden kann, wenn es einem psychisch nicht gut geht, ohne Angst vor Konsequenzen.“

Auch Thomas Mayrhofer, der als pensionierter Rechtsanwalt und ehemaliger Kanzleimanager ehrenamtlich in der sozialen Einrichtung tätig ist, kennt dieses Problem: „Man muss den Mitarbeitern den Urlaub lassen. Und man muss klare Ansagen machen: zwischen 19 Uhr und 8 Uhr gehen keine E-Mails raus. Das würde helfen.“ Der permanente Zeitdruck mache Beschäftigte krank und sei eine direkte Folge der digitalisierten Arbeitswelt.
Für Ingo, Clubhaus-Mitglied mit langer Depressionserfahrung, ist es „ein gesellschaftlicher Druck, der viel stärker ist als früher. Neoliberale Ideologie lenkt die Verantwortung auf die einzelne Person. Wenn du dich optimierst, schaffst du es. Das schafft enormen Druck.“ Das Clubhaus spielt für ihn eine ganz wichtige Rolle für die Stabilisierung der psychischen Gesundheit: „Es ist schon ein großer Erfolg, wenn man nicht weiter in die Krise abrutscht und nicht in die Klinik muss.“
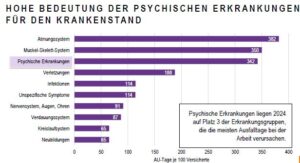
Teilhabe statt Therapie

Das Clubhaus Schwalbennest ist eine von nur zwei offiziell akkreditierten Einrichtungen in Deutschland nach dem internationalen Clubhouse-Model. Ursprünglich in New York aus einer Selbsthilfegruppe entstanden („We Are Not Alone“), gibt es heute weltweit rund 370 Clubhäuser in 33 Ländern. Sie bieten Menschen mit psychischen Erkrankungen eine strukturierte Tagesgestaltung, Gemeinschaft und niedrigschwellige Unterstützung – ohne Therapieauftrag, aber mit verbindlicher, unbegrenzter Mitgliedschaft.
„Das Besondere ist, dass hier jeder freiwillig mitarbeitet, egal wie krank jemand ist“, erklärt Vera Hahn. „Ob jemand nur die Tische abwischt oder einen Computerkurs gibt – jeder kann einen Beitrag leisten. Und jeder profitiert.“
Für Ingo war das entscheidend: „Ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich nach dieser Phase, in der ich versucht habe, in den ersten Arbeitsmarkt zurückzukommen, jederzeit wieder ins Clubhaus kommen konnte – ohne Antrag, niedrigschwellig.“

Zusätzlich bietet das Schwalbennest ein clubhausspezifisches Programm mit sogenannten Übergangsarbeitsplätzen: Mitglieder, die (wieder) in den Arbeitsmarkt wollen, können sich auf verschiedenen Tätigkeiten im Minijob-Bereich ausprobieren. „Das Clubhaus unterstützt bei der Einarbeitung, begleitet die Mitglieder solange es notwendig ist und bleibt immer ein Ansprechpartner für den Arbeitgeber. Momentan haben wir Kooperationen mit fünf Arbeitgebern aus verschiedenen Bereichen, aber wir freuen uns immer über neue Kooperationen“, erläutert Hahn.
Das Modell hat nachweislich Effekte: Regelmäßiger Clubhausbesuch senkt Krankenhausaufenthalte und erleichtert Übergänge zurück ins Arbeitsleben. Im Schwalbennest schaffen das zwar nur 15 bis 20 von 200 Mitgliedern in fünf Jahren, doch es bietet vielen anderen eine stabile Brücke.
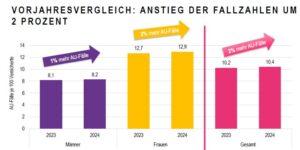
Kooperationen, die sensibilisieren
„Wir waren schon mal zu Besuch in einer Firma und haben dort einen Vortrag gehalten zum Thema: Was sind überhaupt psychische Erkrankungen? Wie äußert sich das? Was kann man tun? Was gibt es für Hilfsangebote?“, berichtet Vera Hahn. Solche Schulungen könnten Chefs und Führungskräfte für Warnsignale sensibilisieren.

Ein besonders erfolgreiches Modell ist das „Seitenwechsel“-Programm: Unternehmen wie Siemens schicken Führungskräfte für eine Woche in ein Clubhaus, um dort mitzuarbeiten. „Die Manager nehmen wahnsinnig viel mit: Soft Skills, Wahrnehmung, Verständnis“, sagt Hahn. „Viele bleiben danach in Verbindung, manche engagieren sich im Beirat.“ Dell bietet seinen Mitarbeitenden ein ähnliches Konzept an, so können sie auch einen Einblick in das Thema „psychische Gesundheit“ bekommen.
Thomas Mayrhofer sieht darin eine Chance, „eine humanere Sprechweise an den Tag zu legen“ und Empathie im Führungsalltag zu fördern. Auch Sponsoring und Hospitationen – vom finanzierten Ausflug bis hin zu Patenschaften für Projekte – verschaffen Unternehmen Einblick in eine für viele neue Welt. „Das ist ja für viele auch was Neues. Wenn man niemanden kennt, der betroffen ist, woher kriegt man denn Einblick?“, so Hahn.

Das Schwalbennest ist kein Therapiebetrieb und finanziert sich dennoch stabil: durch eine Regelfinanzierung aus öffentlichen Geldern und Zuwendungen von Unternehmen und Privatpersonen für spezifische Angebote, wie Freizeit, Feste oder internationalen Austausch. „Wir werden im Prinzip vollständig aus Mitteln des Bezirks Oberbayern getragen“, erläutert Vera Hahn. „Das ist wichtig, weil der Besuch unserer Einrichtung für die Mitglieder dadurch kostenlos ist; sie müssen nur für Essen und Getränke zahlen. Sponsoringaktionen spielen eine immer größere Rolle. „Für uns ist das eine Win-win-Situation“, so Hahn. „Wir bleiben unabhängig und niedrigschwellig, und gleichzeitig bekommen Unternehmen einen Einblick in unsere Arbeit.“
Handlungsempfehlungen für Arbeitgeber
Aus den Aussagen der Interviewten entsteht ein klares Bild, wie Mittelständler psychische Gesundheit fördern können. Vera Hahn betont: „Ich glaube, was wirklich helfen würde, ist eine offene Gesprächskultur. Man muss es aus dem Tabu rausholen, und das muss von oben kommen. Wenn ein Chef klar signalisiert, dass man über Belastungen reden darf, verändert das schon viel.“ Sie plädiert außerdem für mehr Flexibilität: „Es ist total wichtig, dass Beschäftigte Arbeitszeiten reduzieren oder auch mal ein Sabbatical nehmen können, bevor sie aussteigen.“
Thomas Mayrhofer ergänzt: „Ich bin überzeugt, schon einfache Dinge wie regelmäßige persönliche Gespräche oder einmal mit einem Mitarbeiter essen gehen geben dir ein Gefühl, wie es ihm geht.“
Auch Ingo sieht die Verantwortung bei den Betrieben: „Wenn man merkt, dass jemand unter Druck steht, sollte man das ansprechen, aber nicht von oben herab, sondern mit echter Sorge. Und Führungskräfte sollten sich dafür sensibilisieren lassen.“
Hahn empfiehlt zudem, externe Expertise zu nutzen: „Wir können in Firmen kommen, Vorträge halten, aufklären. Das kostet wenig und bewirkt viel.“ Und Mayrhofer sieht darüber hinaus einen Hebel über Nachhaltigkeit und CSR: „Warum schreiben Firmen Nachhaltigkeitsberichte? Weil Investoren das fordern. Ich könnte mir vorstellen, dass psychische Gesundheit darin viel stärker auftaucht. Das würde Druck erzeugen, dass Unternehmen sich bewegen.“

Fazit: Psychische Gesundheit als Wettbewerbsfaktor
Die Stimmen aus dem Clubhaus Schwalbennest zeigen, wie eng Arbeitswelt und psychische Gesundheit verknüpft sind und wie sehr Offenheit, Struktur und Teilhabe helfen können. Für mittelständische Unternehmen ist das nicht nur eine Frage der Fürsorge, sondern auch der Wirtschaftlichkeit. Wer seine Mitarbeitenden langfristig gesund hält, bindet Fachkräfte, senkt Fehlzeiten und stärkt seine Attraktivität als Arbeitgeber. Das Clubhaus-Konzept liefert dafür inspirierende Ansätze.







