Wie kann Deutschland im globalen Wettlauf um Zukunftstechnologien mithalten? Welche Strukturen brauchen Innovationen, um nicht nur zu entstehen, sondern auch Wirkung zu entfalten? Und wie sieht nachhaltiges Wachstum jenseits von Buzzwords aus? Der 18. Deutsche Innovationsgipfel (#18DIG2025) am 14. Mai 2025 gab Antworten – vielfältig, interaktiv und mit klarer wirtschafts- und technologiepolitischer Kante. Dabei diskutierten rund 150 Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und der Start-up-Welt über die Zukunftsfähigkeit des Innovationsstandorts Deutschland.

Bereits das „Start-ups for Breakfast“ markierte den besonderen Spirit des Gipfels: kreative Frühimpulse, Pitches und Gründer:innen-Talks von Unternehmen wie Wandelbots, MotionMiners oder Frailice zeigten, wie innovationsstark das junge Tech-Ökosystem trotz Fundingkrise agiert.
In seinem Grußwort betonte Dr. Manfred Wolter vom Bayerischen Wirtschaftsministerium die Bedeutung von verlässlichen Innovationssystemen: „Wir brauchen ein leistungsfähiges Ökosystem – gerade auch in Krisenzeiten.“ Er verwies auf Bayerns Führungsrolle bei Gründungen und die geplante Aufstockung der Startup-Finanzierung um weitere 750 Mio. EUR. „Staatliches Kapital reicht nicht – wir müssen endlich bessere Rahmenbedingungen für privates Wagniskapital schaffen“, so Wolter weiter.
Demokratie, Fortschritt und „rasender Stillstand“

Den konzeptionellen Rahmen setzte Prof. Dr. Henning Vöpel (cep) mit dem Grand Opening „Das Prinzip Fortschritt – Wege aus der Liminalität“. Seine These: „Wir leben in einer Übergangsphase – Innovation ist unser Instrument, Orientierung zu schaffen.“
Als Antwort auf eine Zeit, die nicht nur rationale Strategien, sondern auch wertebasierten Mut erfordert, prägte Vöpel den Begriff „mutsinnig“ – für Menschen, die Mut und Sinn vereinen. „Wir brauchen heute nicht nur visionäre, sondern mutsinnige Unternehmer. Nur wer mit innerem Kompass handelt, kann in unsicheren Zeiten entschlossen vorangehen.“
Mit großer analytischer Tiefe betonte Vöpel: „Eine Demokratie lebt von der Hoffnung auf Zukunft. Ohne gemeinsamen Fortschrittsbegriff fehlt die Richtung für Innovation.“ Er warnte vor einem „rasenden Stillstand“ – einer Gesellschaft in Bewegung, aber ohne Orientierung. „Es geht nicht nur um Geschwindigkeit, sondern um Richtung. Wer Innovation gestalten will, braucht ein Zielbild – nicht nur Tools.“
Subventionen als Hebel – oder Hürde?

Ein besonderer Akzent lag 2025 auf dem Spannungsfeld zwischen Industriepolitik und internationalem Wettbewerb. Christoph M. Pfaff zeichnete ein klares Bild: „Wir befinden uns in einem globalen Subventionswettbewerb. China, die USA und Europa liefern sich einen Subventionskrieg – Deutschland muss seine Förderarchitektur vereinfachen und digitalisieren“. Er betonte, dass Deutschland mit über 2.500 Förderprogrammen auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene zwar umfangreiche Angebote habe – diese seien jedoch oft ein undurchsichtiger „Dschungel“. Ein Praxisbeispiel verdeutlichte die Tücken: Ein Start-up konnte wegen bürokratischer Hürden seinen Förderantrag nicht digital abschließen – der Elster-Zugang fehlte. Deutschland müsse lernen, „strategisch statt schematisch“ zu agieren, so Pfaff weiter. Die Nutzung öffentlicher Mittel müsse an Wirkung, nicht an Formulierung orientiert sein.
Raumfahrt – Innovationstreiber im Orbit

Ein Highlight war der Talk zum „Innovationsökosystem Weltraum“, moderiert von Christoph Uhlhaas (acatech). Jan Wörner (acatech), Dr. Chiara Manfletti (TUM) und Wolter diskutierten, wie Raumfahrt zunehmend in industrielle Wertschöpfung integriert wird. Wörner: „Weltraum ist keine Romantik – es ist Infrastruktur.“ „20 % der globalen Wirtschaftsleistung sind mittlerweile von Raumfahrt-Services abhängig“, betonte Manfletti und ergänzte: „Space Mobility ist das nächste große Thema – auch für autonome Logistik auf der Erde.“ Sie erläuterte ihre Forschung an wasserbasierten Antriebssystemen für Satelliten sowie KI-gesteuerten Kontrollsystemen. Gleichzeitig wies sie auf die politische Verantwortung hin: „Der Staat muss künftig nicht nur fördern – er muss auch als Kunde auftreten, um Innovationen zu skalieren.“ Wörner mahnte: „Raumfahrt ist nicht teuer – ein Maß Bier auf dem Oktoberfest kostet die Steuerzahler mehr als ein Jahresanteil an Raumfahrtinvestitionen.“ Und: „Die Erkenntnisse aus der Raumfahrt reichen von präziser Erdbeobachtung bis zu Waldbrandprävention durch Satellitenkameras.“
Praxis-Impulse aus Wirtschaft und Wissenschaft

Der Nachmittag lieferte praxisnahe Einblicke: Johannes Landgraf (AUDI) präsentierte Roadmapping als strategischen Kompass, um technologische Unsicherheiten systematisch in Innovation zu überführen: „Wer Innovation führen will, muss Zukunft visualisieren können.“ Er stellte dar, wie bei Audi über 100 Roadmaps systematisch verknüpft sind – ein zentraler Bestandteil der Innovationssteuerung, um sowohl technologische Entwicklungen als auch Geschäftsstrategien abzusichern. „Roadmaps sind mehr als Pläne – sie sind kollektive Denkwerkzeuge“, so Landgraf.
Von Vision zu Umsetzung: Open Strategy & Business Building neu gedacht
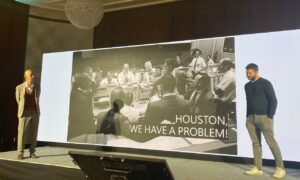
Prof. Dr. Stephan Friedrich von den Eichen (neo) und Manfred Tropper (mantro) zeigten, wie man „re*new new business“ aufbaut – agil, iterativ, impactorientiert. In ihrem Vortrag stand ein zentrales Problem im Mittelpunkt: „Innovation ohne strategische Verankerung ist oft zum Scheitern verurteilt.“ Die beiden sprachen offen über die typischen Fehler im Corporate Venture Building – von fehlendem „Scoping“ über strategielose Business-Modelle bis zu einer Trennung von Strategie und operativem Aufbau. Friedrich betonte: „Wer wirklich Resilienz will, muss Strategie und Umsetzung zusammendenken. Und er muss mutig definieren, was er im Neugeschäft eigentlich sucht.“ Ihre Lösung: ein ganzheitlicher Prozess von Zielbildentwicklung bis zum Aufbau neuer Geschäftsmodelle – gemeinsam mit Unternehmen, ohne klassische Tagessätze, sondern als gemeinsames Wagnis.
KI, Industrie 5.0 & Menschzentrierung: Drei Säulen für die Zukunft der Produktion
In einem weiteren Deep Dive zur Zukunft der industriellen Wertschöpfung wurde deutlich, dass KI nicht nur zur Automatisierung, sondern zur Adaptivität und Menschzentrierung beitragen muss. „Industrie 5.0 bedeutet: Produktion soll nachhaltig, resilient und menschzentriert sein“, so Prof. Dr. Markus Sause (KI-Produktionsnetzwerk Augsburg). Beispiele reichten von KI-gestützter Qualitätskontrolle bis zur intelligenten Montageplanung auf Basis schwankender Rohmaterialqualitäten. Die Vision: „Technologie muss sich dem Menschen anpassen, nicht umgekehrt.“
In den Workshops standen konkrete Methoden im Vordergrund: von der Entwicklung innovationsfreundlicher Räume über die Visualisierung von Sprunginnovationen bis zu Design & Komplexitätsmanagement bei Miele.
Nachhaltigkeit, Leadership & Mut zur Zukunft

Im CxO-Talk trafen sich Vertreter von Start-up-Welt (Magdalena Oehl), Konzerninnovation (Gregor Schrott, Bosch Digital), Mittelstand (Tanja Dreilich, Wieland-Werke) und DeepTech (Christia Piechnik, Wandelbots). Die gemeinsame Erkenntnis: „Transformation ist kein Projekt – sie ist Dauerzustand. Und dafür brauchen wir Führung, die nicht nur managt, sondern inspiriert.“ Es gehe nicht nur um das Wie, sondern auch um das Warum der Transformation. Magdalena Oehl betonte, wie wichtig es sei, in Organisationen echte Verantwortung zu verankern – vor allem bei jungen Unternehmen, die häufig mit geringer Planbarkeit und hoher Dynamik agieren. Gregor Schrott verwies auf die Notwendigkeit, systematisch Innovationsprozesse im Konzern zu verankern, ohne dabei die unternehmerische Energie zu verlieren. Christian Piechnik von Wandelbots hob die Bedeutung von „Purpose“ hervor: Nur wenn technologische Entwicklung mit einer sinnhaften Vision verknüpft sei, könne sie langfristig gesellschaftliche Wirkung entfalten.

In ihrem Vortrag „Nachhaltigkeit neu denken – Cradle to Cradle als Chance für die Zukunft“ betonten Prof. Michael Braungart (EPEA) und Andreas Enslin (Miele) die Notwendigkeit, „von der Ökobilanz zur Designintelligenz“ zu denken. Produkte müssten künftig so gestaltet werden, dass sie nicht nur weniger schädlich, sondern von Anfang an für zirkuläre Prozesse optimiert seien. Enslin hob hervor, dass Design in Zukunft eine strategische Disziplin sein müsse, die ökologische, ökonomische und soziale Anforderungen gleichzeitig bedenkt – und nicht nur „form follows function“, sondern „form follows responsibility“ leitet.
Enactus – Innovation mit Sinn

Dr. Klaus P. Meier (ENACTUS) rundete mit einem leidenschaftlichen Appell an die junge Generation ab: „Zukunft braucht Mut – und Mut braucht Menschen, die handeln, nicht warten.“ Unternehmertum und Innovation sollten seiner Ansicht nach stärker mit Verantwortung und sozialem Impact verknüpft werden. „Wir haben der nächsten Generation kein zukunftsfähiges Geschäftsmodell hinterlassen – das ist unser kollektives Versagen.“ Er präsentierte Projekte von Studierenden, die mit einfachen Mitteln in Afrika Wertschöpfungsketten aufbauten oder in Europa Bildungszugang durch digitale Werkstudentenmodelle verbesserten. Sein Appell: „Wir brauchen Innovation mit ‚Mutsinn‘ – und eine Generation, die Ökonomie, Ökologie und Empathie von Anfang an zusammendenkt.“
Fazit: Innovationsgipfel mit Relevanz
Der 18. Deutsche Innovationsgipfel 2025 zeigte eindrucksvoll, dass Innovation weit mehr ist als Technologie. Sie ist Haltung, Strategie und Verantwortung zugleich. Ob KI, Raumfahrt oder Circular Economy – die Frage ist nicht mehr, ob wir innovativ sein müssen, sondern wie systematisch und wirkungsvoll wir Innovation gestalten. Der Tag in München machte Mut – und Lust auf Zukunft.







