Jahrelang war Marco Schlimpert Topmanager in der Industrie, verantwortete bei Lenzing das Geschäft in Europa und Amerika. Heute begleitet er Unternehmen mit systemischen Aufstellungen und Intuitionsarbeit – Themen, die schnell esoterisch klingen. Im Interview erklärt er, warum er trotzdem von einem harten Business-Werkzeug spricht, wie seine Methode funktioniert und was Mittelständler konkret davon haben.
Unternehmeredition: Herr Schlimpert, Sie waren viele Jahre in der Industrie, haben Restrukturierungen, Turnarounds und große Werke geführt. Wann haben Sie gemerkt, dass klassische Führung an ihre Grenzen stößt?
Marco Schlimpert: Ich komme aus einer sehr zahlengetriebenen Welt: Maschinenbau, Unternehmensberatung, Einkauf, später Produktion und das gesamte Geschäft Europa und Amerika bei Lenzing. Alle zwei Jahre kam die gleiche Ansage: „Wir müssen wieder Leute abbauen.“ Am Anfang war das noch logische Restrukturierung. Aber beim fünften, sechsten Mal dachte ich: Das kann es doch nicht sein. Immer neue Reorganisationen, immer wieder nur Kosten senken – und die Frage, ob das Unternehmen wirklich langfristig stärker wird, blieb offen. Da habe ich gespürt: So wie wir Führung leben, fehlt etwas Entscheidendes.
Was war Ihre wichtigste Erkenntnis aus dieser Zeit?

Zum einen: Zahlen, Daten, Fakten sind wichtig, aber sie erklären nie die ganze Dynamik eines Systems. Zum anderen: Wirkliche Veränderung entsteht, wenn man mit den Menschen arbeitet, nicht gegen sie. Ich habe sehr viel erreicht, indem ich mit Schichtteams in den Werken mitgearbeitet habe, zugehört und „dumme Fragen“ gestellt habe. Aus diesem Nicht-Wissen heraus entstehen die besten Ideen, und zwar aus der Organisation selbst. So habe ich Millionen eingespart, ohne Menschen nur als Kostenblock zu sehen.
Gab es einen persönlichen Wendepunkt, an dem Sie gemerkt haben: Ich muss noch einmal ganz anders auf Führung schauen?
Ja, der kam nicht im Büro, sondern zu Hause. Mein Sohn war damals neun und hat mir schlicht nicht mehr zugehört. Meine Frau war mit drei Kindern daheim, ich ständig unterwegs. Irgendwann war klar: So geht es nicht weiter. Ich bin – auch aus meinem Anspruch heraus, ein liebevoller Ehemann und Vater zu sein – zu einem Familientherapeuten gegangen, in der Hoffnung auf eine Zehn-Punkte-Liste für die Erziehung. Stattdessen hat er nach meiner Lebensgeschichte gesagt: „Marco, du bist kein Mann.“ Das hat mich natürlich geschockt.
Wie hat er das gemeint?
Er hat mir gespiegelt, dass ich als Kind die Scheidung meiner Eltern erlebt habe, von Mutter und Schwestern erzogen wurde und nie ein klares Bild von Männlichkeit bekommen habe. Mein Sohn hat mir unbewusst den Spiegel vorgehalten. Das führte mich zur ersten Familienaufstellung. Dort habe ich sehr körperlich gespürt, was passiert, wenn man seine Herkunftslinie würdigt, in meinem Fall meinen Vater und Großvater. Danach hat sich das Verhalten meines Sohnes schlagartig verändert. Er hat mir ein halbes Jahr später gesagt: „Papa, vorher warst du mir egal. Nach dem Seminar konnte ich dich ernst nehmen.“
Aus dieser sehr persönlichen Erfahrung haben Sie dann Ihre heutige Arbeit entwickelt. Wie kamen Sie von der Familienaufstellung zur systemischen Aufstellung im Unternehmen?
Ich bin Ingenieur. Ich wollte verstehen, was da passiert. In der Ausbildung zur Aufstellungsarbeit sitzen vor allem Lebens- und Sozialberater. Ich war der Topmanager dazwischen und dachte: Das, was da wirkt, muss doch auch im Business funktionieren. Nach ein paar Seminareinheiten musste ich üben, und meine spontane Idee war: Ich probiere es im Unternehmen aus. Bei Lenzing haben wir dann das erste Mal ein Business-Thema aufgestellt: eine SAP-Einführung, die feststeckte.
Was bedeutet „systemische Aufstellung“ im unternehmerischen Kontext ganz konkret?

Vereinfacht gesagt: Wir machen die unsichtbaren Dynamiken eines Systems sichtbar. Wir definieren ein Anliegen – etwa „Warum kommt unser SAP-Projekt nicht voran?“ oder „Welche Produktidee wird erfolgreich?“ – und identifizieren die relevanten Elemente: Projekt, Projektleitung, Befürworter, Skeptiker, Erfolg und so weiter. Diese Elemente werden kodiert, auf Zetteln im Raum ausgelegt. Menschen übernehmen als Repräsentanten eine dieser Positionen, wissen aber nicht, wen sie darstellen.
Das klingt für viele wahrscheinlich ziemlich abstrakt. Was passiert dann im Raum?

Die Repräsentanten stellen sich auf ihre Positionen und achten auf Körperempfindungen, Gedanken, Impulse. Ich frage: „Wie fühlt es sich an? Was bräuchtest du, damit es besser wird?“ Daraus entstehen Bewegungsimpulse: jemand möchte näher an den Erfolg, jemand anderes auf Abstand. So entsteht ein Bild des Systems. Wenn eine stabile Konstellation erreicht ist, decken wir die Rollen auf. Meistens erleben die Beteiligten einen starken Aha-Effekt, weil das Bild erstaunlich genau der Realität entspricht.
Wie stellen Sie sicher, dass das nicht zur esoterischen Spielwiese wird?

Genau das ist mir wichtig. Im Business gelten klare Regeln: Alles, was im Raum entsteht, bleibt im Raum. Sobald es ins Private geht, brechen wir ab. Wir bewerten nicht, sondern beobachten. Und wir übersetzen das Ergebnis konsequent in die Sprache des Geschäfts: Was heißt dieses Bild für EBIT, Wachstum, Investitionsentscheidungen? Ich komme aus der Industrie, habe selbst G&V-Verantwortung für über 1 Mrd. EUR Umsatz getragen. Meine Aufgabe ist, diese „hokuspokusverdächtige“ Methode so zu strukturieren, dass sie als seriöses Business-Tool anwendbar ist.
Können Sie ein gutes Praxisbeispiel aus der Industrie schildern, bei dem Ihre Methode einen konkreten Unterschied gemacht hat?
Gerne. In einem unserer Werke in Indonesien trat plötzlich ein massives Qualitätsproblem bei einer Faser auf. Die Prozessingenieure hatten 50 mögliche Ursachen identifiziert. Jede Ursache zu prüfen, dauert etwa zwei Wochen – das heißt: Zwischen zwei Wochen und zwei Jahren, je nachdem, wo man anfängt. Wir haben die 50 Ursachen kodiert, auf Zettel geschrieben und aufgestellt. In der Aufstellung haben sich drei Zettel klar unterschieden – körperlich spürbar. Es waren am Ende die Messmethode, eine periphere Anlage und eben nicht der Rohstoff. Durch diese Fokussierung konnte das Problem sehr schnell gelöst werden.
Gibt es ein weiteres Beispiel, etwa aus dem Mittelstand?
Ja. Ein schönes Beispiel ist ein mittelständisches Unternehmen mit zwei Geschäftsbereichen: Einer florierte, der andere lief schlecht. In der Aufstellung wurde deutlich: Es fehlte ein Würdigungsritual für die Vergangenheit. Das Unternehmen war oft verkauft worden, niemand hatte den Gründern und früheren Eigentümern je Danke gesagt. Wir haben daraufhin mit dem Management einen Workshop gemacht, in dem die Meilensteine der Geschichte bewusst gewürdigt wurden, bevor wir über Zukunftsstrategien sprachen. Ein halbes Jahr später war die schwache Business Unit klar auf Erfolgskurs.
Sie arbeiten auch mit Investoren und sprechen von „Forecast“ und „Foresight“. Wie sieht das aus?
Ein Deep-Tech-Investor wollte wissen, welches seiner Start-ups als erstes eine große Finanzierungsrunde schaffen wird. Wir haben die Start-ups kodiert, ein Spannungsfeld aus „Marktreife erreicht/nicht erreicht“ und „Markteintrittsbarrieren überwunden/nicht überwunden“ aufgestellt. Die Repräsentanten haben sich positioniert, wir haben interveniert, bis ein stimmiges Bild entstand. Am Ende war klar, welche zwei Start-ups die besten Chancen haben. Das ist kein Ersatz für Due Diligence, aber ein starkes ergänzendes Instrument, um blinde Flecken zu erkennen.
Wie helfen Ihre Ansätze bei Nachfolge oder Unternehmensübernahmen im Mittelstand?
Gerade bei Nachfolge und M&A gibt es viele Fragen, die in keinem Zahlenraum auftauchen: Ist die Nachfolge ernst gemeint? Wird der Übergeber wirklich loslassen oder als Konkurrent wieder auftauchen? Welche unausgesprochenen Loyalitäten gibt es im Management? Mit Aufstellungen lassen sich solche versteckten Dynamiken sichtbar machen. Parallel dazu bleiben alle klassischen Analysen: Bilanzen, Marktstudien, Business Cases. Ich arbeite immer integrativ, nie anstelle der klassischen Methoden.
Kritiker könnten sagen: Das ist alles sehr subjektiv. Was antworten Sie?
Ich finde: Man darf kritisch sein – ich war es selbst. Ich bin Maschinenbauer, ich habe auch gedacht: Das kann doch nicht funktionieren. Nach fünf Jahren und hunderten Aufstellungen sehe ich: Es liefert reproduzierbar relevante Hinweise. Aber ich sage auch: Man sollte nichts kritisieren, was man nicht zumindest einmal erlebt hat. Darum biete ich gerne niederschwellige Testaufstellungen an. Am Ende entscheidet der Unternehmer, welche Schlüsse er daraus zieht und ob die Ergebnisse sich in seinem Business bestätigen.
Wie viel Offenheit braucht ein Unternehmer, um mit Ihnen arbeiten zu können?
Neugier und die Bereitschaft, das eigene Nicht-Wissen zu akzeptieren. Führung heißt für mich: mit kindlichen Augen Fragen zu stellen. Wer glaubt, ohnehin alles zu wissen und nur nach einer Bestätigung sucht, ist bei mir falsch. Wer sagt „Ich habe ein komplexes Thema, das ich mit klassischen Mitteln nicht mehr wirklich greifen kann“, der ist genau richtig.
Sie sprechen viel über Intuition. Welche Rolle spielt sie in der Führung – und kann man sie trainieren?
Intuition ist kein weiches Gegenteil von Zahlen, sondern eine weitere Form von Informationsverarbeitung. Es gibt das Bauchgefühl – gespeichertes Erfahrungswissen im enterischen Nervensystem. Es gibt die Intuition des Unterbewusstseins, das permanent mehr Informationen verarbeitet als unser bewusster Verstand. Und es gibt eine Form von Intuition, die auf Informationen zugreift, die nicht in unserem Körper gespeichert sind. In meinen Formaten trainieren wir, diese Unterschiede wahrzunehmen und bewusst zu nutzen, statt sie zu verdrängen.
Sie haben ein Buch mit dem Titel „Human Intelligence – Wie menschliche Intuition Unternehmensführung transformiert“ verfasst, das demnächst (18.02.2026) erscheint. Was dürfen wir erwarten?
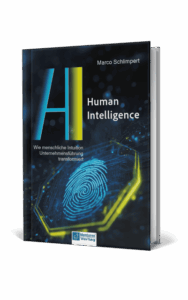
Wenn ein Unternehmer Sie morgen anruft – wie sieht der erste Schritt aus?
Zuerst sprechen wir sehr klassisch: Was ist das Anliegen, was sind Ziele, Kennzahlen, Zeithorizonte? Dann entscheiden wir gemeinsam, ob eine Aufstellung sinnvoll ist und in welcher Form: mit eigenem Managementteam, mit externen Repräsentanten oder beidem. Danach folgt immer ein Anschlusscoaching, in dem wir aus den Bildern konkrete Maßnahmen ableiten. Entscheidend ist: Es muss sich am Ende im realen Geschäft zeigen, in besseren Entscheidungen, Ergebnissen, Beziehungen.
Welche Zukunft wünschen Sie sich für Unternehmen?
Ich erlebe viele Menschen, die innerlich schon damit begonnen haben, die Jahre bis zur Pension herunterzuzählen. Das finde ich traurig. Ich wünsche mir Unternehmen, in denen Menschen ihre Energie wieder gerne einbringen und in denen wir mutig genug sind, neue Wege zu gehen. Stefan Zweig hat einmal gesagt: „Nur der kompetente Geist, der in die Zukunft blickte, konnte die Gegenwart sorglos und mit gutem Gefühl genießen.“ Genau dafür möchte ich meinen Beitrag leisten.
Vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte Eva Rathgeber.
ZUR PERSON

Marco Schlimpert ist Maschinenbau-Ingenieur und war viele Jahre in Beratung und Industrie tätig, zuletzt mit Gesamtverantwortung für das Geschäft Europa/Amerika beim Faserhersteller Lenzing mit über 1 Mrd. EUR Umsatz und rund 2.400 Mitarbeitenden. Heute begleitet er als Berater, Aufstellungsleiter und Autor Unternehmen, Investoren und Mittelständler dabei, mit systemischen Aufstellungen und Intuitionsarbeit verborgene Dynamiken sichtbar zu machen und Transformation wirksam zu gestalten.






